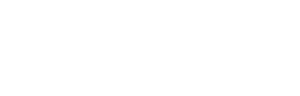Es geht uns gut. Doch geht es uns wirklich gut dabei? Lassen wir hier einmal jene beiseite, denen es tatsächlich dreckig geht. Jene, die sich nicht nur „abgehängt“ fühlen, sondern die tatsächlich abgehängt sind. Die Schwachen und Kranken, die Armen und Verzweifelten. Die, deren Einkünfte nicht einmal ausreichen, um die elementarsten Lebensbedürfnisse zu decken: Wohnen, Essen, Heizen. Die, die tatsächlich schweres Leid erfahren haben oder gerade erfahren. Das ist nicht unser Resort, nicht hier.
Doch ihr vielen anderen, die ihr vom Leben bekommt, was es zu bieten hat, ihr Erfolgsverwöhnten, gut Betuchten, grosso modo Reichen und Schönen, ihr Leistungsbereiten, Genießenden und Konsumierenden, ihr Luxusurlaubenden und Premiumbewussten, ihr Wohlhabenden und vom Wohlstand Verwöhnten. Ihr, die ihr dennoch jammert und quengelt, Neid und Missgunst verbreitet, euren Pessimismus zu Markte tragt, Trübsal blast, Katastrophen an die Wand malt, euch zu Opfern stilisiert: Hey, was ist euer Problem? Ist euer Frust genetisch bedingt?
Schon klar, ihr dürft nicht mit 220 im driverassistierten Modus über die Autobahn flitzen. Wenigstens nicht in Österreich, jetzt schon gar nicht mehr, denn ihr lebt in einer Verbotsgesellschaft und in Extremis ist euer Auto weg. (Außer es erwischt euch keiner, wofür es auch eine gewisse Evidenz gibt.) Ihr müsst jetzt auch noch warten, bis die selbstgerechten Klimakleber endlich vom Asphalt gekletzelt sind, nicht nur bei Rot. Social Media stresst euch. Und ihr habt sowieso Stress. In einer alternden Gesellschaft werdet ihr außerdem ringsum allenthalben mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, jede Menge Greise, was logischerweise eine durchwachsene Stimmungslage erzeugt. Bei einem Durchschnittsalter von 40+ gibt’s halt gesellschaftlich nicht mehr so viel zu lachen, sorry. Unbeschwerte Lebensfreude ist nun mal ein Privileg der Jugend. Doch die hat auch nichts mehr zu lachen: Denn ob in 40 Jahren noch jemand eine Pension bekommt, ist fraglich. Und diese Ungewissheit drückt natürlich letzten Endes auch auf das juvenile Stimmungsbarometer.
Die gute und die schlechte Nachricht: Das alles hat mit eurer persönlichen Stimmungslage – Lebensfreude oder Frust – nur bedingt zu tun. Die eigentlichen Gründe für die Lebensfreudefragilität unserer Existenz liegen nämlich tiefer. Schöpfungsgeschichtlich war die Freude am Dasein – vulgo Lebensfreude – nämlich spätestens mit der Entlassung aus dem Paradies getrübt. Und seither rennen wir – salopp formuliert – dem verlorenen Paradies hinterher. Wie in einem Hamsterrad. Denn am verlockendsten erscheint uns in der Regel ja gerade das, was wir nicht (mehr) haben.
Doch damit nicht genug. Auch der individuelle Einstieg ins Leben ist kontaminiert: Ob wir nun durch den Geburtskanal gepresst oder nach einem Kaiserschnitt sanft dem Uterus enthoben werden, die Freude darüber scheint limitiert zu sein. Wir quittieren unser Eintreffen nämlich mit einem nach Luft schnappenden Lebenszeichen, das nur sehr euphemistisch als Freudenschrei bezeichnet werden kann. Wir fangen uns bei der Geburt vielmehr, so jedenfalls der gerne kolportierte tiefenpsychologische Erkenntnisstand, in der Regel gleich einmal ein Trauma ein – raus da, die ontogenetische Vertreibung aus dem Paradies sozusagen. Uns stellt sich somit postnatal und postparadiesisch die zentrale Frage als Lebensaufgabe: Wie kommen wir (wieder) zu (mehr) Lebensfreude? Kein Zufall, dass diverse Lexika und Wörterbücher die Lebensfreude häufig ex negativo illustrieren, etwa als das „Gegenteil von Anhedonie und Depression“. Wie also Lebensfreude wider alle Wechselfälle, Untiefen und Gemeinheiten des Lebens wiedererlangen?
Oder wie wenigstens die rudimentär noch existierenden Lebensfreudebrückenköpfe und ‑bastionen gegen innere und äußere Feinde verteidigen und möglicherweise sogar einen Keil in anhedonische und depressive Territorien hineintreiben? Anhedonie bezeichnet übrigens die Unfähigkeit beziehungsweise den Verlust der Fähigkeit, Freude und Lust zu empfinden. Es blieb Epikur, dem 341 vor Christus auf der griechischen Insel Samos geborenen Philosophen, vorbehalten, die Lebensfreude aus den Trümmern der postparadiesischen menschlichen Existenz zu rekonstruieren und auf ein vermeintlich solides Fundament zu betten. Epikurs Ethiklehre ziele, heißt es, im Kern auf Erhöhung und Verstetigung der Lebensfreude durch den Genuss eines jeden Tages, womöglich jeden Augenblicks … Dazu gelte es, alle Beeinträchtigungen des Seelenfriedens zu vermeiden und gegebenenfalls zu überwinden, die aus Begierden, Furcht und Schmerz erwachsen können.
Jüngst kam der Autor dieser Zeilen an zwei älteren Herren vorbei, die sich nach einer kurzen Begrüßung austauschten: „Wie geht’s?“, fragte der eine. „Man muss zufrieden sein“, antwortete der andere. Er machte dabei einen durchaus lebensaffinen Eindruck und lächelte – ein bisschen gequält allerdings. Ist es das, was Epikur vor gut 2300 Jahren mit Lebensfreude meinte? „Man muss zufrieden sein.“
Aber sind wir zufrieden? Und gerät der morgendliche Weg zur Arbeit, um nur einen der möglichen Schauplätze zu inspizieren, zur Demonstration kollektiver Lebensfreude? Und wenn nicht: Was hindert so viele daran, morgendlich Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen? Sind es Krankheit, Furcht und Ängste? Konflikte, Kriege, Klimakrise? Oder führt der Weg zur Lebensfreude hypothetisch etwa (nur so ein Gedanke) über die Vermeidung von Erwerbsarbeit? Ist der Schmerz des 21. Jahrhunderts, den es zu überwinden gilt, um Lebensfreude zu erfahren, wenigstens in unseren sogenannten Wohlstandsgesellschaften unser Job? Denn abends an lauen Sommerabenden nach getanem Tagwerk – ist da die Stimmung nicht viel aufgeräumter, um nicht zu sagen teils trunken vor Lebenslust und ‑freude?
In unseren mehr oder weniger postindustriellen Konsumgesellschaften sehen wir uns heute wider alle historische Vernunft umfassend lebensfreudeanspruchsberechtigt.
Wir gestehen uns allerdings nicht bloß ein Anrecht zu, Lebensfreude zu erfahren. Das breite Grinsen ist geradezu Pflicht. Wir mögen, so das Gebot, lächelnd durchs Leben gehen und unsere Lebensfreude möglichst demonstrativ authentisch (ein Widerspruch? Ach nein!) zum Ausdruck bringen, nicht nur downhill auf dem Flowtrail. Es wird von uns erwartet und wir erwarten es von uns. Es gibt einen winzigen Haken: Wir müssen selbst dafür sorgen. Das versuchen viele ja auch redlich. Doch gelingt es ihnen? Gelingt es richtig gut und nachhaltig? Und der tägliche Grantscherben, der Nörgler und Jammerer in uns? Resultiert er aus der Selffulfilling Prophecy, dass es halt leider doch nicht ganz so einfach ist, seine höchstpersönliche Lebensfreude in trockene Tücher zu bringen. Und dass wir vielleicht doch wieder einmal lieber erst morgen damit beginnen. Angst vor dem Scheitern? Und warten wir nicht alle nach wie vor wenigstens ein bisschen darauf, dass ein Wunder geschieht – eine Art Rückkehr ins Paradies; zu ewiger Leichtigkeit und Lebensfreude, wenigstens solange wir leben. Ein Lottosechser. Eine Geschäftsidee, die uns aller Sorgen enthebt, weil sie ohne Mühsal skaliert. Eine Wunderapp, die sich exponentiell millionenfach verbreitet wie zum Beispiel das Coronavirus (das ja auch einigen indirekt zu Wohlstand gereicht haben soll). Eine wenigstens individuell wirksame weltgeistig-dialektische Wendung der Geschichte – nachdem das mit dem kollektiven Ende der Geschichte nicht so ganz geklappt hat; wenigstens noch nicht.
Jetzt mal ehrlich: Wie viele Schilderungen sind uns bekannt, die das verlorene Paradies mit Arbeit in Verbindung bringen? Geben wir jedoch Arbeit und Paradies nebeneinander in die Google-Suchmaske ein, erscheinen flugs jede Menge Einträge zur „Arbeit im Paradies“. Remote. Sehen wir am Display-Horizont bereits die Aura einer neoparadiesischen Epoche heraufziehen? Gelangen wir auf den Spuren Epikurs Jahrmillionen nach unserer Vertreibung durch die Hintertür zurück ins Paradies? Öffnet sich durch eine Finte der viel zitierten Widersprüche der kapitalistischen Ökonomie eine Lücke ins Schlaraffenland – mit all der Schmerz‑, Begierde- und Furchtlosigkeit, die uns zu unbändiger Lebensfreude (selbst)ermächtigt?
Erlauben wir uns doch einmal, ungehemmt optimistisch zu sein – als Start-up-Investition in eine zukünftige Ära universeller Lebensfreude; besser ohne Exit. Also: Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand treten, um eine fröhlich wogende Masse zu bilden, die fortan nur mehr den subjektiv empfundenen Freuden des Lebens frönt. Lebensfreude inklusive. Weltreise, Biken in Istrien oder auf Mallorca, Alpe-Adria-Genusstour, Schrebergarten, Stammbeisl (mit Schnitzelbonus) etc. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Weiteren Hunderttausenden wird es aller Voraussicht nach gelingen, ihren Arbeitsplatz auf paradiesische Palmeninseln zu verlegen. Stichworte: Remote, New Work. Ebenfalls breit grinsend. Schöner als jeder Bildschirmschoner.
All die anderen, die nach wie vor körperlich an ihre Arbeitsstätten gebunden sind: Sie erfahren durch die Verschiebung der Achse ihrer Work-Life-Balance sukzessive Erleichterung. 168 Stunden hat die Woche, davon werden noch (bis zu) 40 gearbeitet. Da muss einem das Grinsen ja in den Mundwinkeln einfrieren. Da ist mehr drin – also logischerweise weniger Arbeit. Und jetzt, bevor skeptische Stimmen laut werden, der Clou – davon konnten weder Hegels Weltgeist noch Karl Marx’ Kapital etwas wissen: Die künstliche Intelligenz (KI) befreit uns Schritt für Schritt nicht nur vom postparadiesischen Arbeitszwang, sondern nachhaltig von der Arbeit überhaupt. Wir ahnen noch nicht einmal, welches Potenzial die KI hat. Eine Glücksmaschine. Die Rückkehr ins Paradies (auf Erden) ist so gut wie geritzt. Freuen Sie sich.
Bis Sie der Wirkungen dieses disruptiven Umschwungs gewahr werden und sich ihre Mundwinkel unwiderstehlich nach oben bewegen, sei Ihnen der Erwerb eines Lebensfreuderatgebers empfohlen.