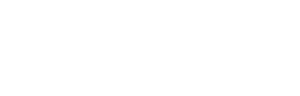Krieg, Krisen, Klimakatastrophe: Und da soll man nicht trübsinnig werden? Zumindest scheinen wir ganz nahe am Weltuntergang dahinzutänzeln. Schließlich wird aktuell mit hoher Akribie der ganze Katalog an Missständen durchdekliniert: die soziale Ungerechtigkeit, ein ungezügelter Hyperkonsum, der zukunftsvergessene Raubbau an der Natur, eine wachsende Wolke lebensverkürzender Schadstoffemissionen, die Abhängigkeit von Despoten aller Art, eine lodernde Bildungsmisere, die Dummheit der Menschen im Allgemeinen, Pandemie, Inflation, Cybercrime – nichts wird ausgelassen. Dazu kommt die völlige Abwesenheit von Planbarkeit.
Wer all das am Radar hat, kann ohne viel Anstrengung den Glauben an das Gute verlieren und sich mit sorgenvollem Blick fragen, ob sich das mit der Zukunft mittelfristig noch ausgeht? Oder man lässt diesen Mix aus Pessimismus, Panik und Pragmatismus erst gar nicht an sich heran – und konserviert sich seine kleine, heile Sicht auf den Weltenlauf. Folgt man der These des Dramatikers Heiner Müller, ist Optimismus ja nur „ein Mangel an Informationen“. Dieses Modell des radikalen Bad-News-Cancelling ist zwar naiv und nervenschonend – wird aber nicht reichen. Es braucht wohl ein windfesteres, aber gleichzeitig realistisches Glücksversprechen. Vielleicht sollte man sich daher – gerade als Mitbewohner der Raunzgroßmacht Österreich – statt ins präsumtive Scheitern öfter ins proaktive Gelingen verlieben. Ein gut dosierter Optimismus wirkt schließlich wie Superfood fürs Ego, macht einen größer und verändert so automatisch die Perspektive.
Denn permanente Schlechtmacherei drückt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch aufs Gesichtsfeld. Man schleicht und schlurft mit depressiven Nebelscheinwerfern durch die Kellergeschosse des Lebens. Aus dieser Froschperspektive erscheint vieles riesig und das meiste unüberwindlich. Probleme wachsen, die Zuversicht schrumpft.
Dechiffriert man den Pessimismus dagegen, zerlegt ihn in das, was er ist, verliert er schnell an Schrecken. Man erkennt seine Eindimensionalität. Wie ein zur „künstlichen Intelligenz“ verklärter Algorithmus, der nur in bestehenden Daten aus der Vergangenheit nach Mustern sucht und daraus versucht, die Zukunft vorherzusagen, kaut auch der Pessimismus nur das sich wiederholend Missglückende und altbekannt Enttäuschende wieder: „Das hat noch nie funktioniert!“, „Das war schon immer so!“, „Das wird wieder danebengehen!“ – eine Negativspirale sich selbst erfüllender Prophezeiungen. „Der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten besteht heute darin, dass der Optimist glaubt, die Zukunft sei ungewiss“, hat Edward Teller diesen Mindset mit der morbiden Ironie eines Physikers charakterisiert.
Aber auch tragikkomische Heiterkeit wird zu wenig sein. Es braucht Optimisten, die reflektieren, relativieren und revoltieren. Die das Neue suchen und entdecken. Optimisten sehen die Möglichkeiten, nicht die Schwierigkeiten; sie wagen das Streben nach Freude und vergiften sich nicht selbst mit sturer Mieselsucht. Sie glauben an das Positive, ohne blauäugig die Existenz des Negativen zu leugnen.
Während Pessimisten nämlich nur in ihrer Tonlage und in ständigem Dacapo Untergangssymphonien abspielen, schaffen Optimisten es, von Moll in Dur, vom Piano ins Fortissimo zu wechseln. Sie lassen anderen Stimmen Raum und finden so immer wieder neue Melodiemuster des Aufbruchs. Statt der Schwerkraft des statischen „Das wird sicher nichts!“ schwingt die Leichtigkeit eines flexiblen „Das wird klappen!“ mit. Optimismus, der etwas auf sich hält, ist daher immer ein tapferes „Trotzdem“, kein halbphlegmatisches „Schauen wir einmal“. Der Optimist sieht Optionen, nicht das Oppositionelle. Er trotzt dem Schicksal das Mögliche ab, er hängt nichts Unrealistischem nach und behält trotzdem die Maximierung von Glück, Freiheit und Freude im Fokus.
Würde man in den USA leben, stünde das quasi im Verfassungsrang. So sind in der Unabhängigkeitserklärung bestimmte „unveräußerliche Rechte“ festgeschrieben, zu denen „Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ (Pursuit of Happiness) gehören. Leicht verkitscht gelten die USA zudem als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Staatlich verordnete Glückssuche in einer Ermöglicher-Kulisse: nicht die schlechteste Kombination. Damit soll nichts beschönigt und idealisiert, keine schiefe Entwicklung geradegebogen, keine Verirrung zur Orientierung hochgelobt werden – aber das kollektive Bekenntnis zur individuellen Glückssuche täte auch dem „Land der großen Töchter und Söhne“ nicht schlecht, das sich in seiner Hymne selbstbeschwörend ja für „zukunftsreich“ hält und „arbeitsfroh und hoffnungsreich“ „mutig in die neuen Zeiten“ schreiten will.
Ein bisserl mehr Daseinsdankbarkeit und neugieriger Mut täten uns gut. Die Optimisten haben sich ohnehin schon auf den Weg Richtung morgen gemacht. Im besten Fall wollen sie das Optimum in einem ganzheitlichen Sinn erreichen – also nicht nur in der Sache selbst, sondern auch in deren Auswirkungen auf die Menschen. Dieser altruistische Ansatz funktioniert selbst in Krisensituationen. Und zwar besser, als man es dem gerade in Engstellen des Daseins zum Egoisten abgestempelten Menschen zutraut. Denn im handelsüblichen Baukasten der Vorurteile findet sich ja üblicherweise ein klares Modell an Kausalzusammenhängen.
Demnach führt eine Katastrophensituation zu einem kollektiven Gefühl der Ohnmacht, zu einer starken Zunahme egoistischer Handlungen sowie zu Massenpanik und wuchernder Kriminalität. Glaubt man soziologischen Studien, stimmt das alles nicht. Demnach warten Menschen in Not nicht ohnmächtig auf Hilfe, sondern formieren Gruppen, geben sich Regeln und Aufgaben, um möglichst vielen Menschen zu helfen. „In Notsituationen kommt das Beste im Menschen zum Vorschein“, resümiert der niederländische Historiker Rutger Bregmann. Er kenne keine andere soziologische Erkenntnis, die gleichermaßen sicher belegt ist und dennoch gänzlich – sehr gerne auch von Medien – ignoriert werde.
Der Mensch täuscht sich offensichtlich gerne über sich selbst. In Zeiten semantischer Volten, in denen die Bezeichnung Gutmensch zur hämischen Beleidigung umetikettiert wird, verwendet der Mensch tatsächlich erstaunlich viel intellektuelle Energie, um zu beweisen, dass es Altruismus eigentlich gar nicht gibt. Dass er in Wirklichkeit nichts anderes sei als das mehr oder weniger getarnte Streben, das eigene Wohlbefinden zu steigern und die eigenen Wünsche zu verwirklichen.
Diese Spielart wird dann als „reziproker Altruismus“ schubladisiert. Was klingt wie eine mathematische Formel, meint in Wahrheit aber nur jenes Handeln, das mit der Redewendung „eine Hand wäscht die andere“ alltagstauglich übersetzt ist: Hinter jeder Hilfeleistung steckt demnach in Wahrheit nur die Erwartung, selbst besser auszusteigen – sei es materiell oder immateriell in Form von Lob und Anerkennung. Mit sortenreinem Altruismus, der allein auf der Motivation beruht, das Wohl des anderen zu ermöglichen, hat das relativ wenig zu tun. Mit schlecht getarntem Egoismus dagegen relativ viel.
Dabei steckt unendlich viel positive Energie im Altruismus. Er trägt ein Flächenbrandgen in sich. Denn nicht nur gute Laune und ein Lächeln wirken ansteckend. Kurze Intervention zur Beweisführung: Legen Sie diesen Text kurz zur Seite und lächeln Sie bei nächstmöglicher Gelegenheit ihr Gegenüber an. Was passiert? Ein ähnlicher Schneeballeffekt wohnt auch im Altruismus. So haben Studien gezeigt (und wird bei der jährlichen „Licht ins Dunkel“-Aktion oder regelmäßigen „Nachbar in Not“-Spendenaufrufen bewiesen), dass sich bei Menschen, die die Spendenbereitschaft anderer erleben, die Bereitschaft, selbst großzügig zu sein, um 150 Prozent erhöht. Manchmal reicht es auch schon, eine Geschichte über eine altruistische Handlung zu hören. Altruismus ist also – ins Start-up-Deutsch übersetzt – „skalierbar“. Keine schlechte Basis für eine bessere Zukunft. Man muss sich nur aufraffen. Und aufrichten.
Denn hebt man den Blick, sieht man die Sonne früher, wird das Trübe klarer, das Mögliche breiter. Man nähert sich wieder dem Denkmuster der Aufklärung, die den Gang der Geschichte als Fortschritt im wahren Wortsinn – als Fortschreiten Richtung bessere Zukunft – versteht und im besten Fall nicht nur Technik und Wissenschaft umfasst, sondern auch Recht, Politik und Moral. Als gelernter Bewohner Österreichs, wo Politikerkarrieren immer öfter vor dem Strafrichter enden, stockt man spätestens an dieser Stelle. Nein, die Welt ist nicht nur gut. Es wird sie weiterhin geben, die Skandale und Affären, die Kriege, Katastrophen und Krisen.
Aber befreit von diesem Senkblei menschlichen Vertrauens an das Gute ist die Welt bei Weitem nicht so schlecht, wie sie gerne hingestellt und verurteilt wird. Es braucht nur richtig dosierte Zuversicht, die keinen flirrenden Illusionen und wolkigen Visionen nachhängt, sondern als Basis für faktenbasiertes Handeln taugt. „Mit der romantischen Sichtweise von Weltverbesserern und Weltrettern hat das wenig zu tun“, differenzierte Wolf Lotter zuletzt in einer scharfsichtigen Gesellschaftsanalyse. Es gehe um eine nüchterne Bestandsaufnahme, die dabei hilft, weiterzukommen. Das Prinzip Hoffnung diene dafür als Kompassnadel, die immer neu eingenordet werden muss. Das sei zwar mühsam, aber so ist sie eben – die Zukunft: Sie ergibt sich nicht von selbst. Sie wird gemacht. Davor muss man sich nicht fürchten.