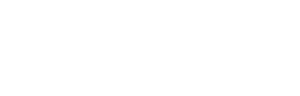Irgendwann im 19. Jahrhundert hatte sich das mit den Universalgelehrten auch erledigt. Das Wissen in den einzelnen Fachdisziplinen hatte derart zugenommen, dass eine allumfassende Kenntnis in einem singulären Menschenhirn nicht mehr möglich war. Ob ChatGPT die Nachfolge von Namen wie Aristoteles, Leonardo da Vinci, Gottfried Wilhelm Leibniz oder Johann Wolfgang von Goethe antreten kann, wird gerade in Echtzeit geprobt. Abseits genialer Generalisten von einst und allwissender Algorithmen von morgen hat sich als belastbares Modell der Alltagsbewirtschaftung in der Zwischenzeit die Spezialisierung in einzelne Fachgebiete bewährt: Es gibt – vereinfacht – die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Kultur, die eine Gesellschaft prägen und stützen, samt allermöglichen Zwischenstufen und Überschneidungen. Gerade auch in diesen Grenzregionen wächst das Originäre einer Gesellschaft. Das „Dazwischen“ ist ein wesentliches Fundament für den Fortschritt. Aber auch Humus für Missverständnisse. Woran liegt das? Und wie lassen sie sich ausräumen? Nicht dass Reibung nicht Wärme entstehen lassen kann und das kreative Potenzial von Konfrontation und Konflikten unterschätzt werden soll– aber einfacher geht es im Diskursiven und Konstruktiven. Woran also scheitert es? Und wie kann es besser gemacht werden?
Im gemeinsamen Durchleuchten des Status quo nach Synergien und Stolpersteinen stößt man dabei bisweilen auf Übersetzungsschwierigkeiten beziehungsweise unterschiedliche „Währungssysteme“: Selten, dass ein Künstler ökonomisch denkt, Wissenschaftler rechnen eher in Publikationen und nicht in Forschungskosten, der unternehmerische Alltag dagegen basiert vor allem auf einem Kalkulieren mit Gewinnen und Verlusten. Das passt nicht immer zusammen. In allen drei Bereichen zeigen sich aber auch deckungsgleiche Bedürfnisse und Blockaden. In der Kultur wie der Wissenschaft geht es abseits der holden Kunst und reinen Lehre um das Erschließen von Finanzierungsquellen von außen, bei Unternehmen um das betriebswirtschaftliche Nutzen von Soft Skills, die der Kunstbetrieb liefert, und neue Denkansätze, die aus der Forschung kommen. Da existieren abseits puristischen Disziplinen denkens viele pragmatische Überschneidungen, da gibt es wenig Trennendes und viele Treffpunkte.
Da wie dort braucht es Freiräume für Innovation, da wir dort liegt dem Suchen nach Disruptivem Kreativität zugrunde. Immer gleicht es einem Kratzen an eingefahrenen Strukturen. Immer ist es eine Einladung, unter die Oberfläche zu schauen und nach neuen Lösungen für alte Probleme zu suchen beziehungsweise Routinen auf deren Brauchbarkeit für künftige Herausforderungen abzuklopfen. Alles mühsam, alles kostspielig, alles mit der Gefahr zu scheitern verbunden. Aber alles lebensnotwendig für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort. Im Strom stürmischer Entwicklungen und wilden Wellengang rudert es sich leichter in eine gemeinsame Richtung.
Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur gelten als tragende Säulen der Gesellschaft. Alle drei stützen sich auf Kreativität. Aber was bringt und kostet das? Und warum sollen wir uns das leisten?
Sind wir tatsächlich eine Kulturnation oder glauben wir nur, eine zu sein?
RINNER /Wir sind im internationalen Vergleich unbedingt eine Kulturnation. Diesbezüglich leben wir auf einer Insel der Seligen. Man darf beispielsweise nicht vergessen, wie viele Menschenweltweit das Neujahrskonzert anschauen, wie viele Theater es in diesem Land gibt, die immer wieder viele Besucheranziehen. Es wird also ein existierendes Bedürfnis bedient: Kultur ist eine Art Lebensmittel.
Aber wie wichtig ist Kultur für einen Wirtschaftsstandort? Ist sie mehr als nur der Zucker am Kuchen?
RINNER /Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, sie ist nur die Garnierung. Aber de facto gehört sie zu den Soft Skills eines Standorts. Unternehmen, die Mitarbeiter aus der ganzen Welt in die Steiermark holen, zeigen mittlerweile auch ein gesteigertes Interesse an einem entsprechenden Angebot für ihre Mitarbeiter und deren Familien. Die Sensibilität für die Bedeutung von Kunst und Kultur ist bei den Unternehmen angekommen. Kunst und Kultursind ein Ansiedlungs- und damit ein Wirtschaftsfaktor. Umgekehrt gehört es zum Selbstverständnis einer mitteleuropäischen Stadt, sich ein Opernhaus, ein Schauspielhaus oder ein Jugendtheater zu leisten. Wenn man daran spart, spart man an der Standortqualität.
LECHNER /Kultur ist wichtig und auch die Wirtschaft profitiert davon –und umgekehrt. Das bemerkt man oft erst, wenn eines davon verschwindet. Geht es den Menschen wirtschaftlich gut, dann haben sie mehr Mittel für Freizeit- und Kulturangebote zur Verfügung, was sich positiv auf die Schaffung eines breiten kulturellen Angebotes auswirkt. Und eine lebendige Kulturszene ist ein wichtiger Faktor, Ortszentren zu beleben und junge Menschen in der Region zuhalten. Gibt es funktionierende Strukturen mit Vereinen, Kulturangeboten, Jobperspektiven und Geschäften in den Zentren, wandert die Bevölkerung nicht ab. Das hilft gegen die Landflucht und damit auch gegen den damit einhergehenden Fachkräftemangel in den Regionen. Und auch die Nebeneffekte eines breiten Kulturangebotes sind enorm, vor allem Gastronomie, Hotellerie oder der Handel profitieren stark von einem vielfältigen Angebot
Wie sehr braucht umgekehrt die Kultureinen prosperierenden Standort? Funktioniert Hochkultur nur in Verbindung mit Hochkonjunktur?
RINNER /Nein, das Theater hat im Laufe seiner über 2000-jährigen Ge-schichte alle Krisen überlebt und wird es auch die nächsten 2000 Jahre tun. Kunst wird es so lange geben, solange es eine kreative Auseinandersetzung mit dem Sein gibt
Was den Kulturbetrieb mit der Wissenschaft verbindet, ist das Faktum, dass beide der öffentlichen Hand viel Geldkosten. In einer Zeit, die von Teuerungen geplagt, von Sparnotwendigkeiten geprägt und nicht zuletzt von Neid getrieben ist: Wie lange soll und kann sich eine derartige Gesellschaft noch einen Wissenschaftsbetrieb leisten?
SCHOBER /Ich hoffe, sie leistet sich das immer – es sei denn, sie will ihren eigenen Abgesang einläuten. Die Frage ist nicht, ob man sich Wissenschaft leistet, sondern eher, ob man sich ein breites Portfolio von Wissenschaft leistet – und zwar von der Grundlagenwissenschaft bis zur angewandten Forschung. Wenn wir aber Fachkräfte und eine Innovationskette in die Zukunft brauchen, dann brauche ich wissenschaftliche Forschung in einer Gesellschaft und an einem Standort unbedingt, da man nur so Fachleute – auch aus angrenzenden Disziplinen – bekommt.
Ein Beispiel, bitte!
SCHOBER /Wenn uns die Demokratie um die Ohren fliegt, dann hilft mir der beste industrielle Prozess nichts mehr, weil man nicht mehr sicher produzieren kann. Dann wären beispielsweise gerade die Sozialwissenschaften wichtig, die eine Beschreibung der Gesellschaft und das „Funktionieren“ der Menschen erklären können und Wege aufzeigen, wie möglichst viele Menschen in Partizipation gehalten werden können.
LECHNER /Unsere Unternehmen interessieren sich ja nicht nur für Umsatzzahlen und das Bruttoinlandsprodukt, sondern auch für weiche Faktoren. Diese Fragen können Sozialwissenschaften aufwerfen und Antworten erarbeiten. Und was die Kosten des Wissenschaftsbetriebes für die Gesellschaft betrifft: Geradedurch die hervorragende Forschung insbesondere im technologischen und medizinischen Bereich und die Vielzahl an darauf aufsetzenden Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht Österreich im internationalen Vergleich so gut da.
Derartige Erklärungen und Übersetzungen kommen aber nicht immer beim Adressaten an. Stattdessen herrscht eine enorme Wissenschaftsskepsis. Warum ist das so?
SCHOBER /Österreich war nie ein wissenschaftsaffines Land. Die Menschen fühlen sich eher der Kultur zugewandt. Wir haben da gegenüber anderen einen unterschiedlichen Kultur- und Wertigkeitsbegriff.
Bereitet es Ihnen als Kulturmanager Sorgen, dass gerade sehr intensiv MINT-Fächer propagiert werden, also junge Menschen für Fächer abseits des Kunst-und Kulturbetriebs begeistert werden sollen?
RINNER /Ich befürchte eher, dass durch die Nachfrage aus der Wirtschaft beispielsweise Fachkräfte im Bereich Haustechnik abgeworben werden. Es ist ein unglaublicher Wettbewerb entstanden, der uns alle erfasst und in dem wir gegenüber der Wirtschaft nicht konkurrenzfähig sind.
LECHNER /Dieses Ungleichgewicht betrifft alle – egal in welcher Branche. Auch Klein- und Mittelbetriebe können oft nicht mit dem Lohnniveau von Großkonzernen mithalten, dafür bieten sie oft mehr Flexibilität oder ein familiäres Betriebsklima. Trotzdem müssen querdurch alle Branchen bereits jetzt Auf-träge abgesagt werden, weil sie wegen Personalmangel nicht abgearbeitet wer-den können.
Was kann man dagegen machen?
LECHNER /Es gibt ein enormes Potenzial: die vielen Teilzeitarbeitskräfte und da vor allem Frauen. Um sie stärker in Beschäftigung zu bekommen, müssen zunächst adäquate Rahmenbedingungen zum Beispiel für die Kinderbetreuung geschaffen werden. Außerdem brauchen wir eine gezielte Zuwanderung und wir müssen endlich beginnen, Menschen, die nach der Pensionierung weiterarbeiten wollen, steuerlich zu entlasten.
SCHOBER /Ergänzen würde ich es noch um eine bessere Besteuerung Vollzeit versus Teilzeit. Wir haben durch unser Steuersystem derzeit eine starke Teilzeitincentivierung. Es dürfen – wie bei der Kinderbetreuung – die Rahmenbedingungen nicht etwas verunmöglichen, was ich eigentlich dringend brauche.
Was bringt eine Kreativszene einem Standort?
LECHNER /Das wird volkswirtschaftlich oft hinterfragt. Mit 3,8 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist sie in etwa gleich groß wie der Tourismus. Oft vergisst man dabei die Kulturschaffenden, die ebenso Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Den ökonomischen Wert der Kreativszene darf man nicht unterschätzen – so bleiben von jedem Euro, den die Kreativbranche ausgibt, 70Cent in Österreich
RINNER /Der kreative Prozess verbindet uns. Er liegt sowohl dem Tun des Kulturschaffenden als auch jenem des Wissenschaftlers und Unternehmers zugrunde. Ob dann immer alles aufgeht, bleibt freilich die große Frage. Aber da muss und darf es auch Enttäuschungen und Einbahnen geben. In der Kultur können wir nicht garantieren, dass jeder Prototyp eine Sensation wird.
SCHOBER /Kreativität hat ja nicht unbedingt den Moment des Erfolges in sich tragend. Eine Zielgerichtetheit von Kreativität wäre ganz gegen die ursprüngliche Idee. Es kann ja auch etwas sehr kreativ sein – aber zu einem negativen Ergebnis führen. Die Möglichkeit scheitern zu können muss man der Kreativität zubilligen.
LECHNER /Das gilt auch für die Wirtschaft. Scheitern muss erlaubt sein. Es geht darum, beim nächsten Mal „besser zu scheitern“ und letztendlich zu „gewinnen“.